Schon gewusst?
Normen, Regelwerke, Grenzwerte
-
▾ ▸
Wie und anhand welcher Normen wird die Luftdichtheit der Gebäudehülle ermittelt?
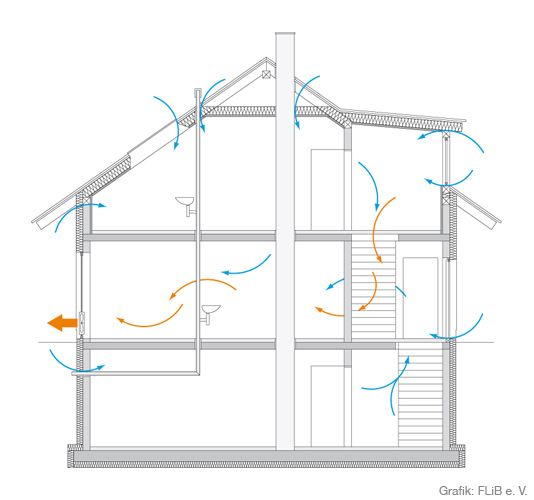 Für die Messung der Luftdichtheit bzw. Luftdurchlässigkeit eines Gebäudes oder eines Gebäudeteils hat sich international das Differenzdruckverfahren durchgesetzt. Dabei wird ein Ventilator in der Regel mit Hilfe einer Plane und einem flexiblen Rahmen luftdicht in eine Fenster- oder Türöffnung eingebaut. Je nach Drehrichtung des Ventilators wird zwischen dem Inneren des Gebäudes und der Außenluft eine Druckdifferenz in Form eines Über- oder Unterdruckes erzeugt. Damit diese Druckdifferenz aufrecht erhalten werden kann, muss der Ventilator laufend eine bestimmte Luftmenge fördern, deren Größenordnung von den Undichtigkeiten (Leckagen) in der Gebäudehülle abhängt.
Für die Messung der Luftdichtheit bzw. Luftdurchlässigkeit eines Gebäudes oder eines Gebäudeteils hat sich international das Differenzdruckverfahren durchgesetzt. Dabei wird ein Ventilator in der Regel mit Hilfe einer Plane und einem flexiblen Rahmen luftdicht in eine Fenster- oder Türöffnung eingebaut. Je nach Drehrichtung des Ventilators wird zwischen dem Inneren des Gebäudes und der Außenluft eine Druckdifferenz in Form eines Über- oder Unterdruckes erzeugt. Damit diese Druckdifferenz aufrecht erhalten werden kann, muss der Ventilator laufend eine bestimmte Luftmenge fördern, deren Größenordnung von den Undichtigkeiten (Leckagen) in der Gebäudehülle abhängt.
Der bei einer bestimmten Druckdifferenz ermittelte Leckagestrom kann zu unterschiedlichen Bezugsgrößen (z.B. Luftvolumen) ins Verhältnis gesetzt werden. Die sich daraus ergebenden abgeleiteten Größen (z.B. Netto-Luftwechselrate bei 50 Pa) können mit der Anforderung an die Luftdichtheit des Gebäudes verglichen werden. Diese Anforderung wird bei der Planung des Gebäudes festgelegt. Sie basiert beispielsweise auf dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) bzw. zuvor der Energieeinsparverordnung (EnEV), auf der DIN 4108-7 oder Anforderungen für den Passivhausstandard. Wie im Detail die Messung durchzuführen ist, regelt die Prüfnorm DIN EN ISO 9972 mit dem deutschen nationalen Anhang (im Rahmen des GEG) und zuvor die DIN EN 13829 (im Rahmen der EnEV).
-
▾ ▸
Welche Anforderungen bzw. Grenzwerte werden an die Luftdichtheit bzw. Luftdurchlässigkeit von Gebäuden gestellt?
Aktuell stellt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Anforderungen an die Gebäudeluftdichtheit. Davor war es die Energieeinsparverordnung (EnEV). Welche Anforderung für das Prüfobjekt verwendet wird, bestimmt der energetische Nachweis meist nach GEG. Weitergehende Anforderungen an die Luftdichtheit können jedoch auch in Förderprogrammen oder für spezielle Gebäudetypen wie das Passivhaus definiert sein.▩ Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Im Gebäudeenergiegesetz wird im § 13 auf die Dichtheit eingegangen. Danach „sind zu errichtende Gebäude so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig nach den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Öffentlich-rechtliche Vorschriften über den zum Zweck der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwechsel bleiben unberührt".Im § 26 „Prüfung der Dichtheit eines Gebäudes" nennt das GEG dann konkrete Grenzwerte.
(1) Wird die Luftdichtheit eines zu errichtenden Gebäudes vor seiner Fertigstellung nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA überprüft, darf die gemessene Netto-Luftwechselrate bei der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 als Luftwechselrate in Ansatz gebracht werden. Bei der Überprüfung der Luftdichtheit sind die Messungen nach den Absätzen 2 bis 5 sowohl mit Über- als auch mit Unterdruck durchzuführen.
Die genannten Höchstwerte sind für beide Fälle einzuhalten.(2) Der bei einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pascal gemessene Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde darf:
■ ohne raumlufttechnische Anlagen höchstens das 3fache des beheizten oder gekühlten Luftvolumens des Gebäudes in Kubikmetern betragen und
■ mit raumlufttechnischen Anlagen höchstens das 1,5fache des beheizten oder gekühlten Luftvolumens des Gebäudes in Kubikmetern betragen.(3) Abweichend von Absatz 2 darf bei Gebäuden mit einem beheizten oder gekühlten Luftvolumen von über 1 500 Kubikmetern der bei einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pascal gemessene Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde
■ ohne raumlufttechnische Anlagen höchstens das 4,5fache der Hüllfläche des Gebäudes in Quadratmetern betragen und
■ mit raumlufttechnischen Anlagen höchstens das 2,5fache der Hüllfläche des Gebäudes in Quadratmetern betragen.(4) Wird bei Nichtwohngebäuden die Dichtheit lediglich für bestimmte Zonen berücksichtigt oder ergeben sich für einzelne Zonen aus den Absätzen 2 und 3 unterschiedliche Anforderungen, so kann der Nachweis der Dichtheit für diese Zonen getrennt durchgeführt werden.
(5) Besteht ein Gebäude aus gleichartigen, nur von außen erschlossenen Nutzeinheiten, so darf die Messung nach Absatz 1 nach Maßgabe von DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NB auf eine Stichprobe dieser Nutzeinheiten begrenzt werden.
▩ Energieeinsparverordnung (EnEV) – Regelung vor dem GEG
Gelegentlich werden noch Gebäude geprüft, die nach der Energieeinsparverordnung berechnet wurden. Diese wurde im November 2020 vom Gebäudeenergiegesetz abgelöst.
Die EnEV geht in § 6 auf die Dichtheit ein. Danach „sind zu errichtende Gebäude so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Wird die Dichtheit ... überprüft, kann der Nachweis der Luftdichtheit bei der ... erforderlichen Berechnung berücksichtigt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 4 eingehalten sind": "Wird ... eine Überprüfung ... durchgeführt, darf der nach DIN EN 13829: 2001-02 mit dem dort beschriebenen Verfahren B bei einer Druckdifferenz zwischen innen und außen von 50 Pa gemessene Volumenstrom – bezogen auf das beheizte oder gekühlte Luftvolumen – folgende Werte nicht überschreiten:■ bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0 h-1 und
■ bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5 h-1.
Abweichend davon darf bei Wohngebäuden, deren Jahres-Primärenergiebedarf nach Anlage 1 EnEV Nummer 2.1.1 berechnet wird und deren Luftvolumen 1.500 m3 übersteigt, sowie bei Nichtwohngebäuden, deren Luftvolumen aller konditionierten Zonen nach DIN V 18599-1: 2011-12 insgesamt 1500 m3 übersteigt, der nach DIN EN 13829: 2001-02 mit dem dort beschriebenen Verfahren B bei einer Druckdifferenz zwischen innen und außen von 50 Pa gemessene Volumenstrom – bezogen auf die Hüllfläche des Gebäudes – folgende Werte nicht überschreiten:
■ bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlagen 4,5 m∙h-1 und
■ bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen 2,5 m∙h-1."▩ DIN 4108-7
Seit Januar 2011 gibt es den überarbeiteten und ergänzten Teil 7 der DIN 4108. Dieser Normteil ersetzt die Ausgabe aus dem Jahr 2001. DIN 4108-7 „legt Anforderungen an die Einhaltung der Luftdichtheit fest". Daneben enthält sie zum Themenbereich Luftdichtheit unter anderem Informationen zur Planung und Ausführung sowie zur Auswahl und Verarbeitung von Bauprodukten. „Sofern die EnEV keine Anforderungen stellt, darf bei Neubauten im Sinne der EnEV und bei Bestandsbauten, bei denen die komplette Gebäudehülle im Sinne der Luftdichtheit saniert wurde, die nach DIN EN 13829:2001-02, Verfahren A, [der] gemessene Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz, n50:■ bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0-1 und
■ bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5-1 nicht überschreiten.
Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen mit einem Innenvolumen von mehr als 1500 m3 wird zur Beurteilung der Gebäudehülle zusätzlich die Luftdurchlässigkeit q50 nach DIN EN 13829:2001-02 herangezogen:
■ Sie darf den Wert von 3,0 m3/(h∙m2) nicht überschreiten."
Ferner werden in DIN 4108-7 n50-Höchstwerte empfohlen, die je nach Lüftungssystem und empfohlener Gebäudepräparation 1,0 h-1, 1,5 h-1 oder 3,0 h-1 betragen sollen. -
▾ ▸
Welche Bezugsgrößen werden für die Luftdichtheitsmessung herangezogen, und was bedeuten nL50 und qE50?

 Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die DIN EN ISO 9972 mit dem deutschen nationalen Anhang von 2018. Bei der früheren Prüfnorm DIN EN 13829 gibt es teilweise andere Bezeichnungen.
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die DIN EN ISO 9972 mit dem deutschen nationalen Anhang von 2018. Bei der früheren Prüfnorm DIN EN 13829 gibt es teilweise andere Bezeichnungen.
Als Bezugsgrößen für den mit der Luftdichtheitsmessung bestimmten Leckagestrom kommen das Luftvolumen (1), die Hüllfläche (2) und die Netto-Raumfläche (3) zur Anwendung. Je nach Bezugsgröße ergeben sie die abgeleiteten Größen bzw. Kennwerte Netto-Luftwechselrate nL50 bzw. Luftdurchlässigkeit qE50. Der Index 50 gibt hierbei die Druckdifferenz 50 Pa an, bei der der Leckagestrom ermittelt wurde. Die Definitionen für die Bezugsgrößen und die Kennwerte werden in der Prüfnorm DIN EN ISO 9972:2018-12 aufgeführt.
▩ nL50: Netto-Luftwechselrate (volumenbezogener Leckagestrom) bei 50 Pa
Die Luftwechselrate bei 50 Pa wird berechnet, indem der Leckagestrom q50 durch das Luftvolumen VL geteilt wird:
nL50 (h-1) = q50 (m3/h) / VL (m3)
Diese Kenngröße gibt an, wie oft bei einer Druckdifferenz von 50 Pa in einer Stunde das gesamte Luftvolumen ausgetauscht wird. Die Netto-Luftwechselrate bei 50 Pa ist die national am häufigsten verwendete Kenngröße. Grenzwerte für diese Kenngröße werden im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und in DIN 4108-7 genannt.▩ qE50: Luftdurchlässigkeit (hüllflächenbezogener Leckagestrom) bei 50 Pa
Die Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa wird berechnet, indem der Leckagestrom q50 durch die Hüllfläche AE geteilt wird:
qE50 (m3/(h∙m2)) = q50 (m3/h) / AE (m2)
Diese Kenngröße gibt an, wie viele Kubikmeter Luft bei einer Druckdifferenz von 50 Pa im Mittel durch einen Quadratmeter Hüllfläche je Stunde hindurchströmen. Die Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa ist eine geeignete Kenngröße zur Beurteilung der Luftdichtheit großer Gebäude. Grenzwerte für diese Kenngröße werden im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und in DIN 4108-7 genannt. -
▾ ▸
Ist mit der Einhaltung von Grenzwerten sichergestellt, dass die luftdichte Gebäudehülle fehlerfrei ist?
Die Luftdichtheitsmessung zur Überprüfung der Anforderungen gemäß GEG und DIN 4108-7 erfolgt zu einem relativ späten Zeitpunkt im Bauablauf. Sie beschreibt die Dichtheit für das gesamte Objekt. Häufig können für die Luftdichtheit wichtige Stellen in der Gebäudehülle schon nicht mehr eingesehen werden. Diese Art der Messung stellt somit nicht sicher, dass bei Einhaltung der Grenzwerte keinerlei Fehlstellen in der Gebäudehülle oder Teilen davon vorliegen. DIN 4108-7, sowohl in der Fassung aus dem Jahre 2001 als auch aus dem Jahre 2011, enthält hierzu entsprechende Hinweise bzw. Anmerkungen. „Selbst bei Einhaltung der ... Grenzwerte sind lokale Fehlstellen in der Luftdichtheitsschicht möglich, die zu Feuchteschäden durch Konvektion führen können. Die Einhaltung der Grenzwerte ist somit kein hinreichender Nachweis für die sachgemäße Planung und Ausführung eines einzelnen Konstruktionsdetails, beispielsweise eines Anschlusses oder einer Durchdringung" - (DIN 4108-7, 2011). Es bieten sich früh angesetzte, baubegleitende Untersuchungen an, bei denen direkt an der Luftdichtheitsschicht das Augenmerk auf zufällige (z.B. lokale Fehlstellen an einer Verklebung) und systematische Fehler (z.B. unter Lasteinwirkung stehende Klebeverbindungen) gerichtet wird. In diesem Zusammenhang können Nachbesserungen erfolgen und Kennwerte (z.B. nL50) abgeschätzt werden. Die Kennwerte haben allerdings nur orientierenden Charakter und sind nicht für den Nachweis der Anforderungen an die Luftdichtheit nach GEG oder DIN 4108-7 geeignet.